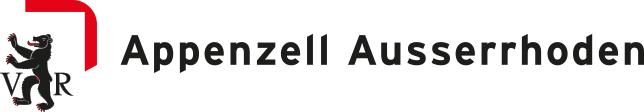SCHAUPLÄTZE
No. 51 | 2025/1Das «Obacht Kultur» N° 51, 2025/1 ist auf Spurensuche.
Auftritt: Serafin Krieger;
Bildbogen: Brenda Osterwalder, Thomas Flechtner, Gaston Isoz;
Texte: Urs Bühler, Davide Tisato, Stefan Wagner u.v.m.
Ausgabe bestellen
Radar
Über die (V)erklärung des Thurgau-Bezugs
von Stefan Wagner
Auf den ersten Blick erscheint die Aufgabe, über den Thurgau-Bezug von Kulturschaffenden zu schreiben, wenig fantasievoll zu sein. Und doch steckt in diesem Vorhaben mehr als die Ausformulierung eines augenscheinlich bürokratischen Attributs. Es gibt den Oberthurgau, aber nicht den Hinterthurgau. Es gibt den Thurgau am Untersee, es gibt ihn am Rhein und selbstverständlich an der Thur. Geografisch ist das gut fassbar, früher oder später wird’s aber schwieriger. Denn Bezüglichkeit ist weit mehr als eine einfache Referenz, wie das der amerikanische Philosoph und Kunstkritiker Arthur C. Danto in seinem vielzitierten Klassiker «Die Verklärung des Gewöhnlichen» beschrieb.
«Ich blicke immer morgens auf den Untersee.» Die Person, die immer morgens auf den Untersee blickt, mag darauf verweisen, dass sie einen Wohnsitz im Thurgau hat. Es könnte aber ebenso sein, dass sie in Baden-Württemberg aufs Wasser blickt. Von beiden Seiten des Sees geht der Blick auf den Untersee. Bei «Ich bin an der Thur aufgewachsen» bedarf es bereits einer Erläuterung, da aufwachsen sich auf eine zeitliche Dauer bezieht. Wie lange wuchs die Person an der Thur auf und in welchem Ort? Was hat sie in der Zeit der Wachstumsphase alles gemacht, welche Schulen besucht? «Ich wirkte an der Murg» schliesslich könnte bedeuten, dass jemand über Jahre in Frauenfeld ein Theater betrieben hat, ohne aber je im Thurgau gewohnt zu haben oder dort je eine Schule besucht zu haben. Einen Thurgau-Bezug zu haben ist nicht trennscharf, ausser man hat ein amtlich beglaubigtes Dokument, das wiederum ein Verfallsdatum besitzt.
Es hilft also alles nichts, als dass der Person, die den Thurgau-Bezug einfordert, grundsätzlich Vertrauen entgegengebracht werden muss. Es ist vielleicht ein Bekenntnis, vielleicht eine ökonomische Dringlichkeit oder einfach nur eine Sache des Herzens, die die Person zu dieser Aussage drängte. Es ist ein wenig wie vor dem Altar: Wenn eine Person sagt: «Ich habe einen Thurgau-Bezug», dann verbindet sich dies mit Rechten und Pflichten. In dubio pro reo.
Im bürokratischen Akt des Thurgau-Bezug-Prüfens steckt also sehr viel mehr als ein Hurra-Patriotismus. Kulturschaffende mit Thurgau-Bezug leben oft in einem Zwiespalt. Sie müssen einerseits aus dem Kanton wegziehen, weil es keine Kunstschulen im Kanton gibt. Sie können aber auch im Kanton wohnen bleiben im Wissen, dass die kulturellen Zentren in Winterthur, Zürich, St. Gallen oder Konstanz an den Grenzen des Thurgaus liegen. Darum ist der Thurgau-Bezug ganz praktisch, er ermöglicht es, einen Teil der eigenen kulturellen Identität zu behalten, sich seiner Biografie zu erinnern oder das kulturelle Netzwerk zu pflegen. Der Thurgau ist so viel mehr als nur ein geografischer Fleck, er ist ein Netz mit Knoten von Menschen. Das ist doch eine humanere Vorstellung des Thurgau-Bezugs als das schnöde Hochziehen von Grenzen.
Stefan Wagner, geboren 1973, studierte Kunstgeschichte, Filmwissenschaften und Philosophie an der Universität Zürich und arbeitete in verschiedenen Positionen und Bereichen im Kulturbereich, u. a. als Assistenzkurator in der Kunst Halle Sankt Gallen. Er ist seit 2019 Geschäftsführer der Kulturstiftung des Kantons Thurgau.